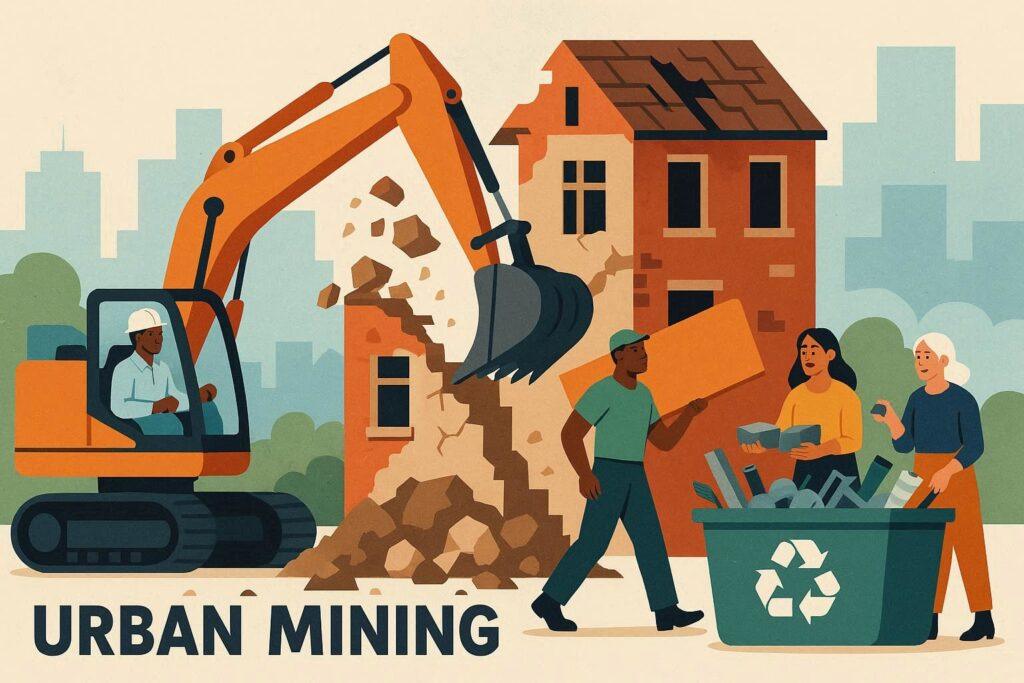Nach langem politischen Stillstand liegt seit dem 15. Juli ein erster Entwurf für das neue Klimagesetz vor. Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) spricht von einem „neuen Zugang“, der auf Konsens statt auf Verbote setzt. Doch ein genauer Blick auf den Inhalt wirft Fragen auf: Wie konkret sind die Pläne? Was passiert, wenn Klimaziele verfehlt werden? Und welche Strukturen sollen dafür sorgen, dass Österreich seinen Beitrag zur Eindämmung der Klimakrise tatsächlich leistet?
Ziele definiert – Weg unklar
48 % weniger Emissionen bis 2030, Klimaneutralität bis 2040
Das neue Klimagesetz soll Österreich auf den von der EU vorgegebenen Pfad führen: Die Treibhausgasemissionen müssen bis 2030 um 48 % gegenüber dem Stand von 2005 reduziert werden. Zusätzlich hat sich die Regierung auf das nationale Ziel verständigt, bis 2040 klimaneutral zu werden.
Diese Zahlen sind ambitioniert und angesichts der aktuellen Emissionsentwicklung herausfordernd. Dass der Gesetzesentwurf diese Ziele in den Mittelpunkt stellt, ist notwendig und richtig. Doch zentrale operative Fragen bleiben offen. Zwar wird ein „Klimafahrplan“ angekündigt, der sektorale Zielpfade definieren soll, doch dieser Fahrplan liegt noch nicht vor und soll erst „in einem nächsten Schritt“ erstellt werden. Ob diese Zielpfade verbindlich sein werden, ist unklar. Das Ministerium verweist lediglich darauf, dass „das Gesamtziel erreicht werden muss“. Ein Satz, der zwar flexibel klingt, aber auch als Einfallstor für politische Unverbindlichkeit gelesen werden kann.

Verantwortung verteilt – aber nicht verbindlich
Wer ist zuständig – und wofür?
Der Gesetzesentwurf kündigt an, künftig klar zu regeln, „wer wofür verantwortlich ist“. Gemeint sind Zuständigkeiten für Emissionsreduktionen in einzelnen Sektoren wie Verkehr, Industrie, Gebäude oder Landwirtschaft. Doch auch hier bleibt das Dokument vage: Es wird nicht deutlich, ob diesen Zuständigkeiten auch rechtliche Konsequenzen bei Nichterfüllung gegenüberstehen.
Diese Unschärfe schwächt das zentrale Steuerungsinstrument des Gesetzes. Ein Zielpfad ohne Verantwortung oder Sanktionsmöglichkeit bleibt ein Appell. Gerade in der Vergangenheit zeigte sich, dass politische Verbindlichkeit häufig dort endet, wo Zielverfehlung keine konkreten Folgen hat. Ob das neue Gesetz diese Dynamik durchbrechen kann, ist derzeit nicht ersichtlich.
Viele Gremien, wenig Steuerung?
Klimacheck, Monitoring, Steuerungsgruppen
Der Entwurf sieht eine umfassende Governance-Struktur vor. Dazu gehören eine Steuerungsgruppe auf politischer und fachlicher Ebene, ein wissenschaftlicher Klimabeirat sowie ein verpflichtender Klimacheck für alle neuen Gesetze und Verordnungen. Ergänzt wird das durch ein Monitoring- und Evaluierungssystem, das regelmäßig prüfen soll, ob Maßnahmen wirken.
Diese Struktur wirkt zunächst differenziert und modern. Doch genau hier liegt auch ein zentrales Problem: Es ist unklar, wie viel steuernde Wirkung von diesen Gremien tatsächlich ausgeht. Bisher fehlen Aussagen darüber, ob der Klimacheck bindend ist – oder bloß eine Prüfinstanz ohne Vetorecht. Ebenso offen bleibt, welche Handlungsspielräume der wissenschaftliche Beirat hat. Es droht ein Übergewicht an Koordination – ohne klare operative Durchgriffsrechte.
Ein Klimagesetz, das mehr will – und weniger tut?
Ausweitung auf Kreislaufwirtschaft und Klimaanpassung
Das neue Gesetz geht über klassisches Emissionsmanagement hinaus: Es integriert auch die Themenbereiche Klimawandelanpassung und Kreislaufwirtschaft. So sollen Investitionen in Hochwasserschutz die Resilienz stärken, während Recycling und Ressourceneffizienz den CO₂-Ausstoß über indirekte Wege senken.
Dieser systemische Ansatz ist grundsätzlich begrüßenswert, da Klimapolitik nicht nur in CO₂-Zahlen gedacht werden darf. Dennoch stellt sich die Frage, ob diese Erweiterung den Fokus vom eigentlichen Ziel ablenkt: der raschen und messbaren Reduktion der Emissionen. Denn obwohl die Kreislaufwirtschaft ein strategisch wichtiges Thema ist, bleibt auch hier unklar, wie und in welchem Umfang diese Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele beitragen – und ob sie gesetzlich verpflichtend werden.
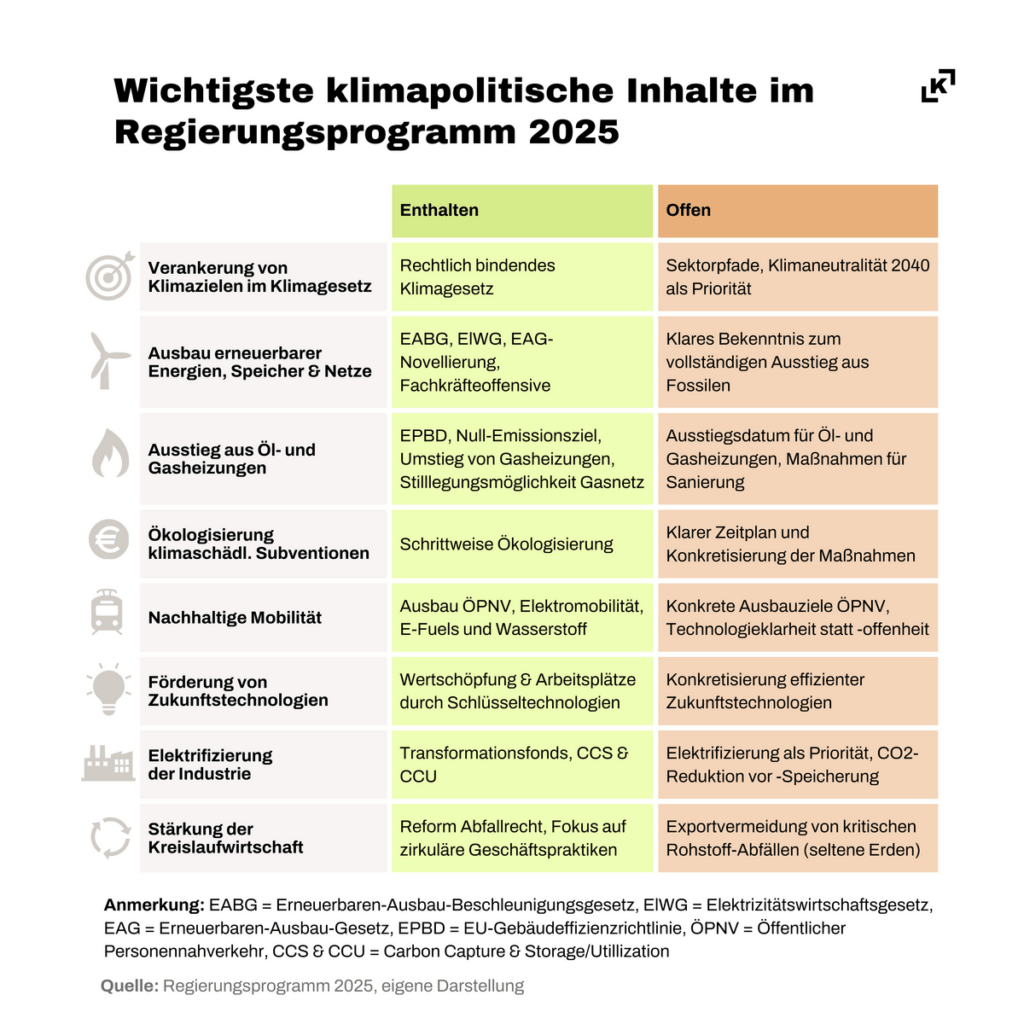
Kritik an Konzept ohne Konsequenzen
Opposition bezweifelt Wirksamkeit des Gesetzes
Die erste öffentliche Reaktion kam von der ehemaligen Klimaministerin und jetzigen Klubobfrau der Grünen, Leonore Gewessler. Sie kritisierte den Entwurf scharf als „Gesetz voller Sesselkreise“, das keine einzige Wohnung kühler mache. Sie warf der Regierung vor, strukturell wirksame Klimapolitik zugunsten symbolischer Maßnahmen zu vernachlässigen und weiterhin Projekte wie die Lobau-Autobahn zu fördern – anstatt in den öffentlichen Verkehr oder den Klimabonus zu investieren.
Ob man Gewesslers Wortwahl teilt oder nicht – der Hinweis auf fehlende Verbindlichkeit im Gesetz ist berechtigt. Der Entwurf zeigt viele Strukturen, viele Prüfungen, viele Gruppen. Aber wenig Konsequenz. Gerade in einem Bereich, der so stark auf Umsetzung und Messbarkeit angewiesen ist, bleibt das zentrale Versprechen bisher offen: Wer haftet, wenn Ziele verfehlt werden?
Fazit: Governance ohne Durchgriff?
Der vorgelegte Entwurf für das neue Klimagesetz zeigt gute Ansätze: Die strukturelle Ausweitung auf Kreislaufwirtschaft und Klimaanpassung ist zukunftsorientiert, der Aufbau eines wissenschaftlich begleiteten Systems ist sinnvoll, und die geplanten Zielpfade können eine Grundlage für sektorale Verantwortung sein. Doch ohne klaren Fahrplan, ohne rechtlich verankerte Pflichten und ohne Konsequenzen bei Zielverfehlung droht das Gesetz seine zentrale Funktion zu verfehlen.
In der Klimapolitik zählt nicht nur der politische Wille, sondern vor allem die Wirksamkeit der Instrumente. Ein Gesetz, das alle mitreden lässt, aber niemanden verpflichtet, droht zu einem Papiertiger zu werden – oder, wie die Kritikerin es formulierte: zu einem „Gesetz voller Sesselkreise“.
Quellen:
- BMLUK: Die Eckpunkte des neuen Klimagesetzes
- Ö1 Mittagsjournal (15.07.2025): Totschnig (ÖVP): Entwurf für Klimagesetz liegt vor
- Die Presse: Totschnig legt Entwurf für Klimagesetz vor
- Der Standard: Regierung führt Klimacheck bei Gesetzen ein